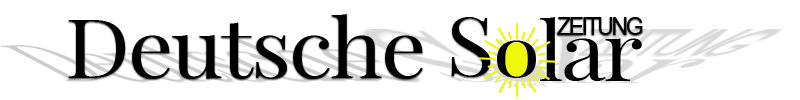Mit der neuen Solarförderungsregelung gibt es zwei Betreibermodelle mit unterschiedlichen Vergütungssätzen.
Im Modell Eigenverbrauch erhalten Eigentümer, die einen Teil des von ihnen erzeugten Stroms selbst verbrauchen, künftig bis zu 8,2 Cent pro Kilowattstunde (kWh) Strom, den sie in das öffentliche Netz einspeisen. Dies entspricht der bisherigen Regelung im Jahr der Inbetriebnahme und in den folgenden 20 Jahren. Das sind damit 25 % mehr, als ursprünglich im Gesetzentwurf vorgesehen war.
Bei dem Modell der Volleinspeisevergütung erhält der Erzeuger bis zu 13 Cent pro Kilowattstunde und damit doppelt so viel wie bisher, wenn er den gesamten erzeugten Strom beim Netzbetreiber einspeist. Davon profitieren vor allem Hausbesitzer, die genügend Dachfläche haben, um eine relativ große Anlage zu installieren.
Besitzer von neuen Solaranlagen stehen also vor der Wahl. Entweder sie verbrauchen einen Teil des von der Anlage erzeugten Stroms selbst und sparen damit Geld auf ihrer Stromrechnung oder sie speisen den Strom vollständig in das öffentliche Netz ein. In diesem Fall ist die Einspeisevergütung deutlich höher, aber Sie sparen keinen Cent auf Ihrer Stromrechnung.
Stiftung Warentest hat ausgerechnet, was je nach Größe der Anlage, Strompreis und Möglichkeit des Eigenverbrauchs günstiger ist. Mehr Informationen finden Sie hier.
Gute Renditen sind zwar prinzipiell möglich, aber gleichzeitig sind Solaranlagen in letzter Zeit immer teurer geworden, obwohl die Einspeisevergütungen erhöht wurden. Um eine gute Rendite zu erzielen, müssen Hausbesitzer auf den Preis der Anlage achten und den zu erwartenden Ertrag und die Kosten der Anlage sorgfältig kalkulieren: Experten der Stiftung Warentest zeigen Ihnen, mit welchen Anschaffungs- und laufenden Betriebskosten Sie rechnen und welche steuerlichen Regeln Sie beachten müssen, wie viel Strom Sie ins Netz einspeisen können und wie viel Sie sparen.
Die voraussichtliche Rendite Ihrer geplanten Solaranlage können Sie mit dem kostenlosen Solarrechner der Stiftung Warentest ermitteln.